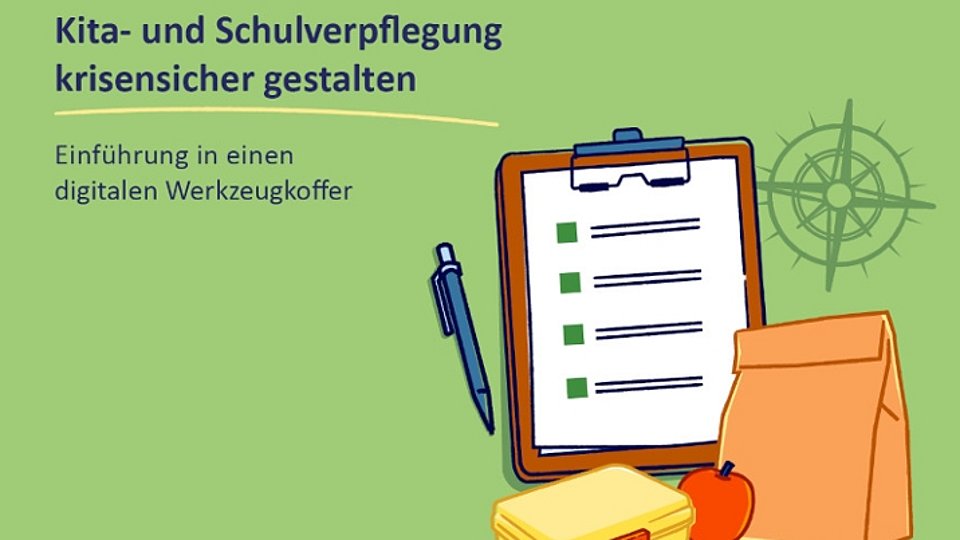Carolin Kahlisch, Senior Researcher am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT)
Wir sprachen mit Carolin Kahlisch, Senior Researcher am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT) in Berlin, zu den Ergebnissen des Projektes „Modulare Lösungsstrategien für eine krisensichere Kita- und Schulverpflegung“
Sie haben für die Kita- und Schulverpflegung relevante Risiken und Krisen dokumentiert. Wie bewerten Sie Ihre Erkenntnisse?
Für uns waren die Ergebnisse insofern überraschend, wie viele Risiken die Mittagsverpflegung in Kitas und Schulen beeinflussen können. Als IZT beschäftigen wir uns mit systemischen Risiken. Wir haben dafür einen Katalog entwickelt, den wir grundsätzlich auf Infrastruktursysteme anwenden. Von daher waren wir auf einige mögliche Risiken vorbereitet, andere waren unerwartet. Dazu gehört insbesondere das Risiko der Personalengpässe, die derzeit das größte Gefährdungspotenzial für die Kita- und Schulverpflegung darstellen. Personal- und Fachkräftemangel kann zu Störungen oder sogar Ausfällen der Versorgung führen. Wir fanden es außerdem interessant, dass Probleme, die das gesamte Bildungssystem betreffen, sich auf die Kita- und Schulverpflegung herunterbrechen lassen. In allen Bildungsbereichen sehen wir sowohl einen Fachkräftestau als auch große Finanzierungslücken, die sich in mangelhafter Infrastruktur zeigen. Das lässt sich auf Kita- und Schulküchen übertragen.
Wie sind Sie zu Ihren Ergebnissen gekommen?
Gestartet sind wir mit einer Literaturrecherche. Dabei hat sich gezeigt, dass es zwar viel Literatur zur Kita- und Schulverpflegung an sich gibt, aber so gut wie nichts in der Kombination mit Risiko- oder Krisenmanagement. Wir haben dann verschiedene Stakeholder befragt, für wie robust sie die Wertschöpfungsstufen der Kita- und Schulverpflegung gegenüber bestimmten Risiken einschätzen, also z. B. Stromausfall, Personalengpass, Technik- oder IT-Ausfall. Zuletzt haben wir Experteninterviews mit Stakeholdern geführt. Zu ihnen gehörten größere und kleinere kommunale und freie Kita- und Schulträger, Cateringunternehmen, Mitarbeitende der Vernetzungsstellen und relevante Fachleute aus der Wissenschaft. Zum Abschluss haben wir eine Art Round-Table veranstaltet und unter anderem Lösungsansätze und mögliche Strategien diskutiert. Unsere Untersuchungsergebnisse basieren auf Fallbeispielen und Szenarien, die wir wissenschaftlich bewertet und mit der Praxis diskutiert haben.
In Ihrem Projekt unterscheiden Sie Risiko- und Krisenmanagement. Welche Unterschiede bestehen?
Beim Risikomanagement müssen sich Verantwortliche im Grunde genommen der Weltlage bewusst sein und sich präventiv fragen, welche Risiken in ihrem Betrieb zu relevanten Störungen führen können. Für Caterer oder Kita- und Schulküchen sind das etwa Personalmangel, Cyberkriminalität, Lieferengpässe im Bereich von Lebensmitteln oder steigende Preise. Diese Risiken müssen sie auf ihre eigenen Prozesse übertragen und Schwachstellen identifizieren. Das Krisenmanagement geht noch einen Schritt weiter und fragt, welche Schritte im konkreten Ausfall oder einer Störung vorgenommen werden müssen: Gibt es etwa einen Notfallplan, mit dem in einer bestimmten Situation gut und präzise reagiert werden kann? Gibt es Maßnahmen, mit denen sofort eine alternative Mittagsverpflegung zur Verfügung gestellt werden kann? Mit wem muss im Falle einer Störung kommuniziert werden?
Konnten Sie bei den Befragten ein Problembewusstsein für die Störanfälligkeit der Speisenversorgung feststellen?
Aus meiner Sicht ist das Problembewusstsein sehr gering, auch wenn es bei einigen Akteuren vor dem Hintergrund aktueller Krisen langsam wächst. Wenn die Essensversorgung grundsätzlich funktioniert, wird das Risiko- und Krisenmanagement zu häufig ausgeblendet. Ich glaube, je größer die Produktionsküche oder das Cateringunternehmen, desto höher ist das Problembewusstsein und desto sensibler das Risikoempfinden etwa für Produktionsausfälle. Kleinere Einrichtungen mit weniger zu versorgenden Kindern reagieren eher pragmatisch und versuchen erst im akuten Störfall eine Lösung zu finden. Insgesamt würde ich sagen, dass sich Einrichtungen und Träger in dieser Hinsicht auf ihre Caterer verlassen, mit denen sie vertragliche Vereinbarungen haben.
Welche Risiken müssen langfristig abgesichert werden?
Ich möchte drei langfristige Risiken nennen, die zu Störungen führen können und für die wir jetzt noch Folgen abmildern können. Das ist erstens die Personalverfügbarkeit, die gegenwärtig schon problematisch ist und als Problem weiter wachsen wird. Hier ließe sich heute zum Beispiel mit attraktiveren Arbeitsbedingungen dafür sorgen, dass Personal für diese Branche gehalten bzw. neues Personal gewonnen wird. Zweitens sehen wir eine Marktkonzentration im Bereich der Cateringunternehmen, d. h. es gibt immer weniger Anbieter, die gleichzeitig immer größer werden. Damit nimmt die Abhängigkeit der Bildungseinrichtungen von Catering-Unternehmen zu. Im Falle eines Systemausfalls wären ad hoc sehr viele Kitas und Schulen und eine große Anzahl Kinder und Jugendlicher betroffen. Hier wäre eine Strategie, diese Unternehmen zu mehr Risikomanagement zu motivieren oder zu verpflichten. Und drittens möchte ich das Technikversagen nennen. Wir haben es im Bildungssystem mit einem sehr großen Investitionsstau zu tun, der auch die Ausstattung von Kita- und Schulküchen betrifft. Da ist unter anderem veraltete und störanfällige Küchentechnik zu nennen, veraltete Wasser- oder Stromleitungen in Kitas oder Schulen, es geht aber auch um die Frage von räumlichen Ressourcen, die für eine gut ausgestatte Küche sowie für Speiseräume oder Mensen fehlen.
Welche Krisen halten Sie für akut?
Das sind zum einen Stromausfälle. Wir reden dabei nicht so sehr von großflächigen Blackouts, sondern eher von regional oder lokal auftretenden Ausfällen, die zu kurzfristigen Verpflegungsausfällen führen können. Unsere Befragung hat gezeigt, dass Catering-Unternehmen und Großküchen darauf nur in wenigen Fällen vorbereitet sind. Akute Krisen werden auch durch Cyberkriminalität ausgelöst, die ein systemisches, dynamisches Risiko darstellt, das sich aufgrund von KI schnell entwickelt und immer neue Angriffsmöglichkeiten schafft. Diesbezüglich sehe ich bei den Akteuren kein großes Problembewusstsein, etwa bei der Digitalisierung von Prozessen – die zwar viele Vorteile bringt, aber gleichzeitig ein Einfallstor für Angriffe ist. Wir haben im Rahmen eines anderen Projektes festgestellt, dass viele Kommunen in Deutschland gleiche IT-Dienstleister beauftragen. Im Angriffsfall würde das großflächige Ausfälle bedeuten, von denen in dicht besiedelten Gebieten mehrere Millionen Menschen betroffen sein können. Auch hier sehen wir eine Marktkonzentration kritisch. Und nicht zuletzt kann eine dünne Personaldecke bei Caterern, in Kita- oder Schulküchen bei einer Grippewelle oder Epidemie zu akuten Versorgungskrisen führen.
Gibt es Prozessschritte, die störanfälliger sind als andere?
Grundsätzlich können alle Wertschöpfungsstufen für Unterbrechungen oder Störungen anfällig sein. Zwei Prozessschritte stechen aber als wenig robust heraus: Die Lagerung von Lebensmitteln, die von einer sicheren Energieversorgung abhängig ist, und die Zubereitung von Speisen, bei der technische Defekte, Stromausfälle oder Personalengpässe dazu führen können, dass nicht wie üblich produziert werden kann.
Bestehen Unterschiede bei Risikowahrscheinlichkeit und Krisenbewältigung im Stadt-/Landbezug?
Die Risiken würde ich für Stadt und Land ähnlich bewerten. Einen Unterschied sehe ich nur beim Risiko der Marktkonzentration, von dem Bildungseinrichtungen auf dem Land im Störfall eher betroffen sein könnten, als städtische Einrichtungen, die mehr Ausweichmöglichkeiten bei anderen Caterern, Studierendenwerke, Krankenhäusern etc. finden können. Krisenbewältigungsstrategien sind auf beiden Seiten gleich, wenngleich sie sich auf dem Land aufgrund kleinteiligerer Strukturen und kürzerer Wege in Kommunikation und Zusammenarbeit möglicherweise anders darstellen als in der Stadt.
So vielfältig die Risiken und potentiellen Krisen: Welchen zentralen Rat würden Sie Trägern, Einrichtungen und Speisenanbietern geben?
Es gibt einen Basis-Rat, der auch Kernaussage des Projekts ist: Es braucht zuerst ein Bewusstsein für Risiken und mögliche Krisen und deren reale Auswirkungen auf die Verpflegungsstrukturen. Das ist vielen nicht bewusst, weil andere alltägliche Herausforderungen der Speisenversorgung relevanter erscheinen. Wir halten es für wichtig, alle Risiken durchzuspielen und zu schauen, wie robust die eigenen Strukturen sind. Und dann positiv gerichtet zu überlegen, welche Maßnahmen die Strukturen robuster machen und welche Maßnahmen im Krisenfall in einen Notfallplan gehören.
Wie lässt sich das besprechen, ohne Unruhe oder Panik zu schüren?
Ich denke, ein Leitungsteam kann bewusst damit umgehen und mögliche Risiken in Ruhe mit allen relevanten Stellen und Mitarbeitenden besprechen. Im Gegenteil bin ich davon überzeugt, dass das helfen würde, sicherer zu werden, statt dass es Unruhe weckt. Wenn etwa Caterer und Träger gemeinsam einen Notfallplan erarbeiten, können sie ein gemeinsames Verständnis davon entwickeln. Hilfreich ist, wenn solche Prozesse gut begleitet sind, zum Beispiel von den Vernetzungsstellen.
Wen sehen Sie hier in der Verantwortung?
Für mich sind das zuerst die kommunalen oder freien Kita- und Schulträger, die auch für die Organisation der Speisenversorgung verantwortlich sind. Es ist wichtig, dass sie das Risiko- und Krisenmanagement auf ihre Agenda setzen und alle Beteiligten an den Tisch holen – vielleicht zunächst für eine erste Abfrage, welche Maßnahmen in den Einrichtungen schon gelten und welche Erfahrungen einzelne Kitas oder Schulen bereits gemacht haben. Sicher lassen sich bestimmte Notfallmaßnahmen auch in Ausschreibungen verankern, aber ich denke, dass die Vielfalt an Risiken und Krisen eine gemeinsame Verantwortlichkeit und Abstimmung bedingt. Für die Absicherung langfristiger Risiken und für das Krisenmanagement generell, auch etwa im Falle von Pandemien, sollten weitere Verantwortungsebenen aus Land und Bund einbezogen werden. Hier fehlt es nach wie vor an Strategien.
Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview fand im Oktober 2025 statt.